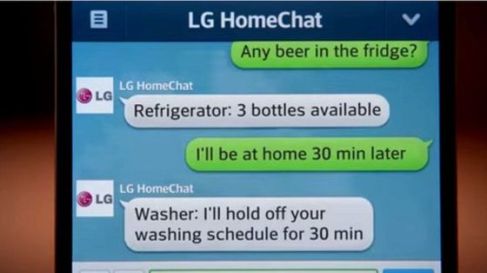Drehbuch des eigenen Lebens redux
In was für einer Sorte Film würden Sie denn selbst am liebsten leben?
In einem Krimi? – Lieber nicht.
In einem Action-Thriller? – Auch nicht.
In einem Katastrophenfilm? – Sicher auf keinen Fall!
In einer romantischen Komödie? – So viel falsche Gefühle muss man aushalten können.
In einer Folge einer Sitcom? – Bitte, bitte, bloß nicht.
In einem deutschen Autorenfilm? – Gääähhn!

Glücklicherweise hat man keine Wahl, in welchem Film man in seinem Leben zu spielen hat. Die Rolle kann man sich teilweise noch selbst aussuchen, aber der Plot steht in der Regel. In unserem Fall heute 2020 ist das ein sehr chaotischer Mix aus Horrorfilm, Realsatire und Banal-Drama mit einer Vielzahl von Einsprengseln aus Krimi, Thriller, Katastrophe, Sitcom und – im Idealfall – Liebesfilm.
Würde man die Statisten in diesem Film, der Realität heißt, befragen, es würde die Mehrzahl von ihnen wahrscheinlich gerne aus dem Projekt ganz aussteigen, andere würden gerne das Script umschreiben, andere die Besetzungsliste radikal ändern. Die wenigsten würden sich begeistert zeigen von dem, was einem so jeden Tag im Film „Das ist Dein Leben“ geboten ist.
Alle Sicherheiten sind dahin
Die Liste der Zumutungen, die unser Drehbuch für uns in der heutigen Zeit bereithält, ist lang, sehr lang. Immer schneller rinnt die Zeit. Die Beschleunigung unseres Lebens ist real körperlich spürbar. Stress, Lärm, Anspannung, Hetze, Getrieben-Sein sind die Folgen. Spätestens seit die Digitalisierung wirklich zuschlägt, hat sich unser Leben komplett verändert: intensiviert und so hektisch wie nie.
Alle Sicherheiten sind dahin. Wir sind so spektakulär säkularisiert, dass wir nicht einmal recht wissen, warum wir die verschiedenen Feiertage feiern. Wie war das mit Ostern nochmal? Und mit Pfingsten? Weihnachten, o. k. das sind Krippe und Christkind und irgendwo ist ein Ros entsprungen. Ros, nicht Ross??? Kapitalismus und Demokratie, die letzten Ideologien, die uns noch geblieben sind, kränkeln auch schon beträchtlich. Und die Quanten-Physik nimmt uns noch die letzte Bastion der Logik. Dort kann plus zugleich minus sein und alles kann unendlich in vielen Zuständen gleichzeitig existieren.
Ein apokalyptischer Mix
Auch die einzige große Konstante, unsere Welt samt Natur, Klima, Flora und Fauna, ist nicht mehr das was sie einmal war. Was haben wir Menschen da über die letzten Jahrhunderte alles angerichtet! Brennende Wälder, Plastikmüll bis in die tiefsten Abgründe der Meere, Gift, Strahlung überall – und zugleich sterben so viele Tiergattungen aus wie noch nie zuvor. Alles aufgrund unseres eigenen Zutuns…
Der apokalyptische Mix, den das Drehbuch unserer Gegenwart für uns bereithält, ist für sensible Gemüter schwer aushaltbar. Schon weil er scheinbar so wenig tröstende Momente zu bieten hat. Und trotzdem – das ist nun mal so in Filmen – gibt es doch so viele Momente, in denen man Glück, Liebe und Zufriedenheit erlebt. Und das Ganze ohne schlechtes Gewissen. Schließlich ist unsere Psyche sehr begabt im Verdrängen und Ausblenden – und das ist gut so.
The Vertigo Years
Ich habe mit dem Drehbuch, das unsere Gegenwart für uns bereit hält, weit weniger Probleme, seit ich „Der taumelnde Kontinent – Europa 1900 – 1914“ von Philip Bloom lese. (Den Titel des englischen Originals: „The Vertigo Years“ – übersetzbar als: Jahre die einen schwindlig werden lassen, finde ich viel passender.) Das ist ein Geschichtsbuch der besonderen Art. Es behandelt – sehr gut lesbar – die Wirtschafts-, Wissenschafts-, Psychologie-, Kultur- und Gesellschaftsgeschichte des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Es ist wirklich beruhigend zu lesen, wie sehr die Menschen auch damals unter extremen Veränderungen litten. Die Welt beschleunigte – relativ gesehen – ähnlich dramatisch wie wir es heute empfinden. Damals wurden die Züge wirklich schnell. (Teilweise kam man schneller von Hamburg nach Berlin als heute.) Autos kamen auf, das Flugzeug war erfunden. Ein Rekord nach dem anderen wurde gebrochen – und von den Menschen – schaudernd – gefeiert.
Neurasthenien, der Burn out der 20er-Jahre
Die Menschen wurden mit einer Unmenge an Informationen konfrontiert: damals noch per Zeitung und Buch. Gewissheiten lösten sich auf. Die Wissenschaft bewies ein ums andere Mal, dass die Bibel nicht recht hatte. Ob es um die Abstammung des Menschen vom Affen (Darwin) ging oder um den Ursprung der Welt im Kosmos, die Menschen damals hatten ihre großen Probleme, das intellektuell und vor allem psychisch zu verkraften.
Da hilft die neu entwickelte Wissenschaft der Psychologie. Damals litten die Menschen an Neurasthenien, psychischen Erschöpfungszuständen wegen der rasenden Veränderungen: politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Veränderungen. Heute nennen wir das Burn Out-Syndrom. Erstmals gab es Stars. Stars des Theaters Eleonora Duse), der Musik (Caruso) und natürlich des (Stumm-)Films. Menschen wollten alles über sie wissen, sie waren Stadtgespräch.
Geschichte wiederholt sich nicht?
Apropos Stadt. Immer mehr Menschen zogen in die Stadt. Weil es dort Jobs gab, aber weil dort auch neue Freiheiten zu erleben waren. Künstlerische Freiheiten, gedankliche Freiheiten – und auch sexuelle Freiheiten. Und wo neue Freiheiten auftauchen, werden sie immer von Menschen und Systemen bekämpft, die – ökonomisch, politisch oder intellektuell – viel zu verlieren haben und da populistisch geschickt die Illusion einer sicheren und idyllischen Vergangenheit propagieren, die es so nie gegeben hat.
Die Parallelen zu heute sind frappant, wenn man die Zeit des frühen 20. mit dem frühen 21. Jahrhundert vergleicht. Nein, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber es ist auf eine seltsam schöne Art tröstend zu sehen, dass wir als Menschheit, als Gesellschaft schon einmal durch ähnlich stressige und unübersichtliche Zeiten gegangen sind wie heute. Es ist interessant zu beobachten, wie wir Menschen immer wieder irren, wenn wir meinen, jeweils stets in den schlimmstmöglichen Zeiten zu leben.
Mögest Du in interessanten Zeiten leben
Und es ist auf eine gewisse Weise beruhigend zu sehen, dass wir Menschen, aus allen solchen Situationen irgendwie noch rausgekommen sind. Selbst wenn die damals herrschenden Mächte den mörderischen Lösungsansatz des Modernitätsdilemmas in Form eines Weltkrieges gewählt haben (und dann gleich noch einmal – samt Holocaust und Hiroshima). Gut, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Zumindest hoffen wir das mal ganz feste.
“May you Live in Interesting Times” war das Motto der Biennale 2019 in Venedig. Ganz Italien ist mit diesem Satz überschwemmt, denn jeder Illy-Kaffee hier wird seitdem aus Tassen mit diesem Aufdruck getrunken und mit Zucker aus Zuckertüten mit diesem Aufdruck gesüßt. Denn Illy-Kaffee ist in diesem Jahr der Sponsor der Biennale. Ein mutiger Ansatz in einem Italien von heute. Italien lebt definitiv in sehr „interessanten Zeiten“. Und wirklich glücklich darüber ist kaum jemand.
„May You Live in Interesting Times” gilt ja – auch laut Wikipedia – als alter chinesischer Fluch. Will man einem Menschen von Grund auf etwas Böses wünschen, dann gönnt man ihm „interessante Zeiten“. Dieser Fluch ist ein wunderbarer urbaner Mythos, der sich durch kein überliefertes chinesisches Sprichwort untermauern lässt. Bekannt gemacht hat diesen angeblichen Fluch Robert Kennedy, der ihn 1966 in einer Rede zitierte. Seine Rede schloss er, sehr nonchalant. „Like it or not, we live in interesting times!“ (Also auch schon 1966 waren die Zeiten wieder mal interessant.)
Merke: Solch ein Fluch funktioniert nicht, solange man in derselben Welt leben muss wie der unseres Widersachers! Und wenn es denn ein Fluch ist, ist das der Fluch der Evolution. Wir haben uns – willentlich oder eher nicht – immer für die interessante Lösung entschieden und so die Evolution bis zum Anthropozän vorangetrieben. Jetzt geht es darum, die Geister, die wir weckten, zu bändigen.
Aber war das nicht immer schon unsere dringendste Aufgabe?






 Meine deutlichste Erinnerung an Onkel August aber war der Geruch, den er mit seinem Besuch ins Haus brachte – und der dann für Tage noch leise die Räume durchzog. Alkohol, Zigarre, alte Wolle und alter Mann. Nicht direkt unangenehm, aber irritierend und fremd. Keinen Geruch, den ich vermisse. Aber die Erinnerung macht klar, wie viel sich seitdem geändert hat. Zum Besseren, auf alle Fälle, für unsere Geruchssensoren. – Warum auch immer solch Erinnerungen wach werden, wenn man leise amüsiert und mäßig interessiert vor alten Straßenbahnen im
Meine deutlichste Erinnerung an Onkel August aber war der Geruch, den er mit seinem Besuch ins Haus brachte – und der dann für Tage noch leise die Räume durchzog. Alkohol, Zigarre, alte Wolle und alter Mann. Nicht direkt unangenehm, aber irritierend und fremd. Keinen Geruch, den ich vermisse. Aber die Erinnerung macht klar, wie viel sich seitdem geändert hat. Zum Besseren, auf alle Fälle, für unsere Geruchssensoren. – Warum auch immer solch Erinnerungen wach werden, wenn man leise amüsiert und mäßig interessiert vor alten Straßenbahnen im