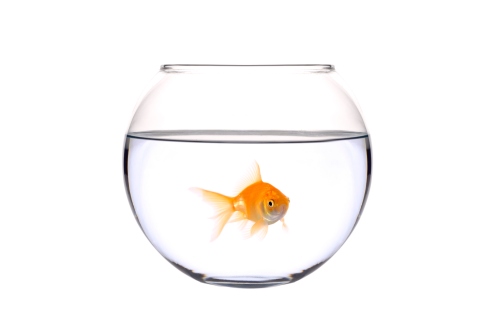Mein Besuch auf der Blauen Couch
Die Email kam überraschend. Einladung auf die Blaue Couch von Gabi Fischer auf Bayern 1. Zugegeben, ich bin kein sehr eifriger Hörer von Bayern 1, ja generell von terrestrischem Radio. Wenn Radio, dann spezielle Sender aus aller Welt via Streaming, aus den USA (z. B. NRP), aus Großbritannien (immer noch gut: BBC!) oder auch aus dem Nachbarland Österreich (FM4). Natürlich auch mal die jungen Programme des BR.

Dabei halte ich Radio auch weiterhin für unterschätzt. Na ja, vielleicht nicht Radio per se, sondern alle zeitgemäßen auditiven Inhalte, ob Podcasts, Streaming, Hörbücher, Hörspiele, also alles, was informiert, unterhält oder berieselt, ohne dass dafür das Auge in Anspruch genommen werden muss. Dabei geht es nicht nur darum, beim Autofahren ein wenig Ablenkung zu bekommen. Ich finde es auch schön, statt zu lesen, in der S-Bahn zu hören und trotzdem Umgebung und vor allem die umgebenden Menschen beobachten zu können. Nicht immer sind die so unterhaltsam – oder so seltsam – dass man ihnen zuhören muss.
Zukunftsdiskussion als Podcast
Jetzt gibt es auch mich als Podcast. Der Bayerische Rundfunk stellt alle Beiträge der Blauen Couch als Podcasts zum Hören und/oder zum Download zur Verfügung.
Hier der Link zum Podcast auf Bayern1.de. (auch zum Download)
Und hier der Podcast zum Download auf Soundcloud.
Das Thema der Gesprächstunde mit Gabi Fischer war die Zukunft, die Ängste davor – berechtigt oder nicht – und wie man Mut schöpfen kann, die Herausforderungen der Zukunft, die – ziemlich unerbittlich – auf uns warten, meistern zu können.
Schön, das ich ansatzweise die Gelegenheit hatte, im Gespräch auf der Blauen Couch meine Ideen zu einer Art Zukunftsmut kurz skizzieren zu können.
Schritt 1: Evolution akzeptieren & leben
Schritt Eins wäre, sich generell zuzugestehen, dass wir alle Kinder der Evolution, also einer permanenten Fortentwicklung sind. Wir wären nicht Mensch, wohl kaum Lebewesen, gäbe es die Evolution nicht. Also ist stets Veränderung unser typisches Erbgut. Das müssen wir uns einfach eingestehen und akzeptieren. (Man kann ja dann immer noch jammern, dass das alles immer schneller geht, wenn es ohne Jammern nicht geht.)
Schritt 2: Eigene Veränderung lieben lernen
Ein zweiter Schritt wäre meiner Meinung nach, einmal kurz in sich zu gehen und nachzudenken, ob man der, der man vor 10, 20 oder 30 Jahren gewesen ist, auch heute noch gerne wäre. Ich für mich verneine diese Frage entschieden. Ich bin froh, dass ich mich weiterentwickelt habe. Klar habe ich die meiste Mühsal, die Ängste, die ich unterwegs hatte, die peinlichen Momente und die Niederlagen überwiegend vergessen, verdrängt. Die Errungenschaften, die Glücksmomente, die Momente, wo man etwas wider Erwarten geschafft hat, müssen auch erst mühsam hervorgekramt werden. Aber ich bin heute der, der ich früher so nie war. Und das macht mich froh.
Warum nicht diese Haltung auch an die Zukunft anlegen? Klar, es wird oft schwierig werden, es wird Widerstände, Ängste, Niederlagen und unschöne Momente geben. Aber mit ein wenig Glück und Geschick werden auch in Zukunft die positiven Momente überwiegen. Vor allem, wenn wir uns aktiv darum kümmern, wenn wir unsere Zukunft in die Hand nehmen und proaktiv gestalten, anstatt sie uns von anderen ungefragt vorgesetzt zu bekommen: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Nach dem Motto: Friss oder stirb.
Schritt 3: Anpassungsfähigkeit schätzen lernen
Vor allem aber sollten wir uns – und das ist Schritt Nummer Drei – sehr bewusst daran erinnern, welche Mühsal, welche Frustrationen, welche Niederlagen, welche Probleme, welche Verluste wir im Leben schon bewältigt haben. Manchmal vielleicht mit Glück, oft aber sicher auch mit Geschick, oft auch nur mit Geduld und im Laufe der Zeit. Wir übersehen, so wie wir schlimme Momente gnädigerweise schnell vergessen können, zu welchen Leistungen wir fähig sind.
Die Wissenschaft hat in letzter Zeit in vielen Studien und Metastudien (das sind Studien, die Studien zusammenfassen) nachgewiesen, dass die Adaptionsfähigkeit des Menschen ungeheuer groß ist. Zugleich ist aber der Glaube der Menschen daran unvergleichlich gering. Wir unterschätzen uns und unsere Fähigkeit, Änderung und Wechsel nicht nur auszuhalten, sondern auch zu bewältigen. In Wahrheit genießen wir es sogar – mit Ablauf der Zeit, und im gnädigen Blick zurück sind wir dann manchmal sogar stolz darauf.
Inertia, die Lust und Manie der Beharrung
Die zwei Gegner unseres Anpassungstalents sind die Angst und die sogenannte Inertia, das uns innewohnende Beharrungsvermögen, das man vielleicht besser Beharrungslust nennen sollte. Angst haben wir vor Veränderung weniger, weil sie Arbeit und Mühe bei der Anpassung macht, sondern weil wir nicht wissen, ob wir dabei Gewinner oder Verlierer sein werden. Das ist das Wesen jeder Veränderung, dass die Spielregeln und die Spielklötzchen andere sind. Die Gewinner und Verlierer werden neu bestimmt. Und ehe man Verlierer ist, blockiert man lieber die Veränderung. Man verpasst dabei aber auch die Chance, auf der Seite der Gewinner zu sein.
Zudem sind Menschen als solche sehr beharrlich. Wir sind zwar die Motoren der Evolution, sind aber selbst das trägste Moment in diesem Spiel. Die Technik hat sich drastisch verändert. Was im Großen und Ganzen geblieben ist, wie es war, das sind wir Menschen mit unseren Bedürfnissen, unserem Verhalten und unseren Denkmustern. Wir tragen noch heute biologische Grundmuster aus vorhumanen Zeiten mit uns herum (Gänsehaut!), und ähnlich archaisch ist unser Hormonhaushalt (Testosteron, Adrenalin!) und sind es viele unserer emotionalen Spontanreaktionen. Zugelernt haben wir in erster Linie nur kulturell.
Schritt 4: Zukunftskultur mit klaren Zielen
Daher müssen wir uns eine Zukunftskultur schaffen. Das wäre für mich der Schritt Vier. Wir müssen über Zukunft reden, diskutieren, streiten und dabei Schritt für Schritt weiterkommen. Aber Schritt für Schritt wohin? Wir brauchen Zielvorgaben. Das heißt, wir müssen die möglichen, wichtiger noch die nötigen Veränderungen offen benennen und dann diskutieren, ob das o. k. ist – und vor allem, wie wir dahin kommen. Dafür braucht es vielleicht gar nicht die vielzitierten (und von Helmut Schmidt desavouierten) „Visionen“. Es wäre schon genug, klar zu benennen, wo die Reise hingehen soll.
Solche eindeutigen Zielvorgaben scheut die Politik heute wie der Teufel das Weihwasser. Die Wirtschaft ist da zu Teilen anders, also in den Teilen, die sich zu den möglichen Gewinnern zählen. Die Teile der Wirtschaft, die zu verlieren fürchten, verstecken sich hinter den Politikern und ihrer Beharrungsmanie und stützen sie. Also herrscht ein beliebiges Vor-sich-hin-wursteln, das sich von einer unwichtigen oder übersteigerten Hysterie zur nächsten hangelt.
Zu wünschen wäre eine Politik, die klare Ziele hat. Über die kann man sich austauschen und streiten. Über ein konturloses Allerlei namens „alternativlose“ Realpolitik, kann man das nicht. Das erinnert an ein Fahren im dichten Nebel, in dem man sich nur an den Rückspiegeln orientiert. Da wäre es doch besser, man wüsste, wohin die Fahrt gehen soll.
Wir haben nichts anderes als unsere Zukunft
Angela Merkels „Wir schaffen das“ war in Ansätzen eine solche Zielvorgabe. Nur hätte man gerne gewusst, was sie mit „das“ konkret meint. Und noch schöner wäre gewesen, es wäre auch mal grob skizziert worden wie das geschafft werden soll.
Zukunftsforschung, oder „Zukunftssoziologie“, wie ich das lieber nenne, sammelt und analysiert die Ideen und Optionen, wohin es gehen kann und wie es gehen soll – im Rahmen der bekannten Möglichkeiten, die uns unser Planet und unsere gesellschaftliche Verfassung erlauben. Und sie versucht, Ängste zu nehmen – und Mut zu machen. Wir haben nichts anderes als unsere Zukunft! Also kümmern wir uns gefälligst darum…