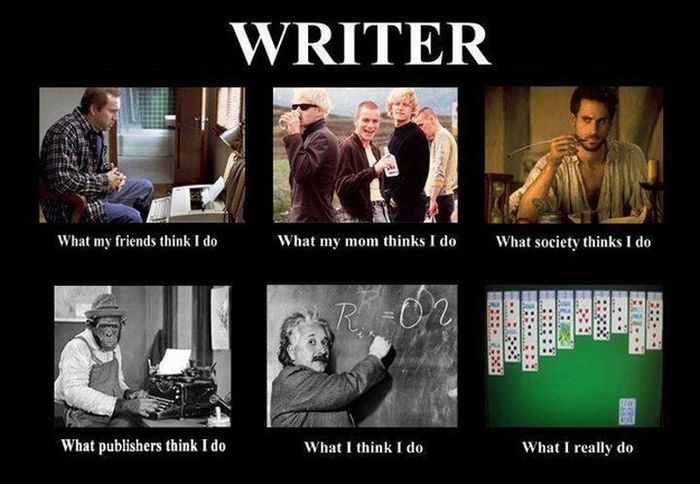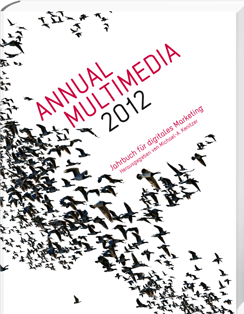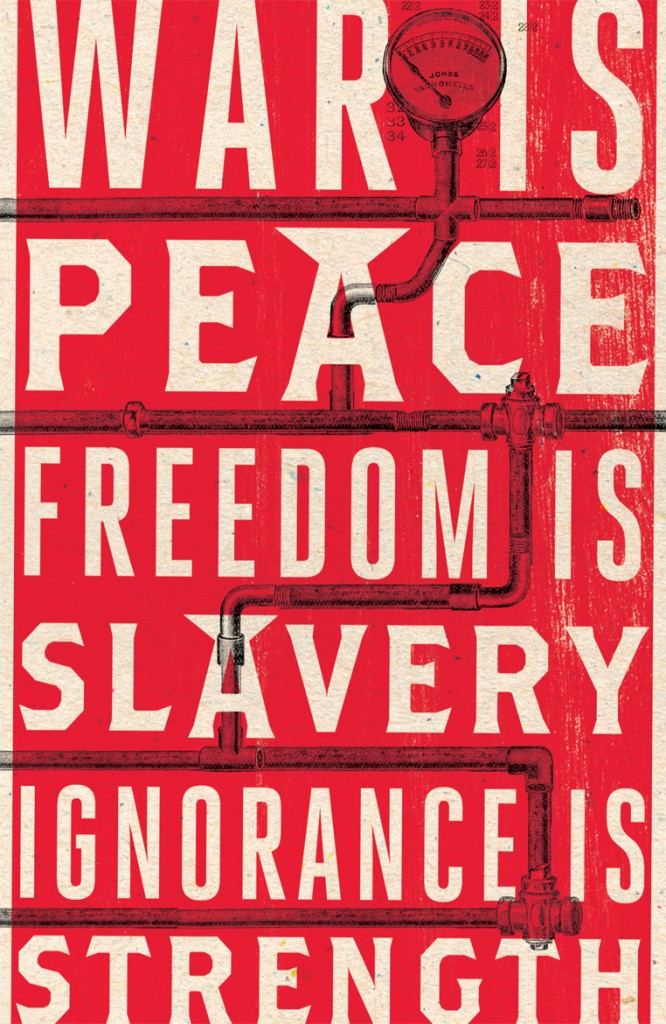Italien 2012: alles in bester Ordnung?
Das Leben in Italien geht seinen gewohnten Gang. Nach außen hin ist alles in Ordnung. Es gibt eine Krise? Na gut, aber das muss doch keiner mitbekommen. Italien ist schon immer perfekt gewesen „bella figura“ zu machen. Egal wie schlimm es zuhause aussieht und wie klamm man sein mag, mit einem guten Anzug, einer stolzen Haltung und einem strahlenden Lächeln auf den Lippen ist noch immer Eindruck zu machen bei der passeggiata, beim abendlichen Bummeln durch die Hauptstraße, auf dem Hauptplatz oder der Uferpromenade.

Und wie der einzelne Bürger, so setzt auch der Staat alles daran, eine „bella figura“ zu machen. Alles geht seinen Gang. Die Auslagen sind voll, die Läden sind offen, die Busse fahren, alles prima. Und sie es hinter den Fassaden aussieht, geht keinen etwas an. Fragt man die Italiener nach der Krise, wird kurz über Monti, die gestiegenen Benzinpreise und höhere Gebühren für Gas, Elektrizität etc. gejammert. Aber das hat man schon immer so getan. Das war bei Berlusconi nicht viel anders.
Berlusconi, wer bitte ist das?
Letzterer passt inzwischen auch gar nicht mehr zur „bella figura“. Silvio Berlusconi ist zur Unfigur geworden. Nicht dass man Schlechtes über ihn sagt. Man will nur gar nicht mehr über ihn reden. Oder über Ugo Bossi. Man will nicht einmal mehr seinen Namen erwähnen. Die unsensiblen Touristen, die immer noch über Silvio reden wollen, furchtbar. Der Name steht einfach auf dem Index.- Aber auch über Monti mag man nicht wirklich reden. Jeder weiß, dass es zu ihm keine Alternative gibt. Aber er verkörpert als Person einfach zu sehr die Krise, die man so gar nicht sehen will, weil sie hässlich ist (bella figura!). Also ist Monti auch irgendwie tabu.
Gott sei dank, sind in Italien erst in einem Jahr Wahlen. Was da passieren mag, welche Parteien sich bis dahin selbst zerstört haben – wie die Lega Nord – oder sich in Wohlgefallen aufgelöst haben – wie Berlusconis Wahlverein, keiner weiß es. Und ob sich bis dahin neue, echte Alternativen im Parteienspektrum gebildet haben mögen, die wählbar sind? Jenseits der Protestbewegung vom Satiriker und öffentlichen Enfant terrible Beppe Grillo ist da nichts absehbar. (Sie kennen Beppe Grillo nicht? – Man stelle sich als Deutscher einfach eine ziemlich hochtourige und politische Mixtur aus Urban Priol und Atze Schröder vor.)
Interessant wird die Geschichte, wenn man ein wenig hinter die Fassaden schaut. Denn es wird derzeit in Italien weiterhin viel gebaut. Zum Beispiel Straßen. Letztere sind eine große Konjunkturmaßnahme. Derzeit werden alle großen Autobahnen Italiens verbreitert – auf drei oder vier Spuren. Und das in einer Zeit, wo so gesittet Auto gefahren wird wie noch nie in Italien. Die hohen Benzinpreise haben auch noch den letzten Raser gebändigt. Es wirkt schon sehr kurios, wenn ein BMW X6 oder ein Mercedes SLK Benzin sparen, indem sie auf der Autobahn im Windschatten von LKWs fahren. Ein in Italien derzeit nicht seltenes Bild.
Bauboom ohne Geld
Aber es wird auch privat viel gebaut. In jeder kleineren Stadt prägen etliche Baukräne das Stadtbild. Der Bauboom erklärt sich zum einen dadurch, dass Bargeld zu Immobilien umgewandelt wird. Gemunkelt wird, dass hier auch viel Schwarzgeld den Weg zurück in die Realwirtschaft findet. Gebaut wird aber auch auf Pump. Das Geld leihen aber nicht Banken, die geben nämlich so gut wie keine Kredite mehr, egal wie viel Sicherheiten geboten sind. Die Banken sind nicht mehr flüssig, das Geld, das die EZB massenhaft zur Verfügung stellt, wird von dem Finanzbedarf der Banken fast völlig aufgesogen.
Trotzdem wird gebaut. Aber auf eine sehr fatale Methode. (Auch hier gilt: „bella figura“!) – Man baut, die Bauarbeiter sind billig, weil die Arbeitslosigkeit hoch ist. Und die Arbeiter werden erst mal nicht bezahlt. Das ist in Italien seit je her üblich. Erst nach einem halben oder dreiviertel Jahr, wenn der Bau schon weit fortgeschritten ist, wird gezahlt. Per Scheck. Per vordatiertem Scheck, der erst zwei oder drei Monate später eingelöst werden kann. Oder per vordatiertem Scheck, den der Bauherr bekommen hat und weiterreicht. Und auch die Baustoff-Lieferanten werden so (virtuell) bezahlt.
Die verkrustete Gesellschaft
So hat nach außen hin erst mal alles seine Ordnung. Aber wehe, wenn in ein paar Monaten die Schecks fällig werden. Wenn nur einer in der Kette der vordatierten Schecks platzt, funktioniert das komplette System nicht mehr. Pleiten sind dann unausweichlich. – Auf diese Weise wird die komplette Krise Italiens nach hinten datiert. Immer in der Hoffnung, dass irgendwie doch noch Geld in das System kommt. Von der EU, der EZB oder gar von Investoren, die Anleihen kaufen. – Wehe das klappt nicht, dann ist Monti schuld. Oder die EU. Oder die Deutschen. Oder Merkel. Aber fürs Erste ist alles in bester Ordnung. „Bella figura“ rules!
Und natürlich machen auch die Banken „bella figura“. Kredite haben sie ja keine mehr zu vergeben, also machen sich die vielen Bankangestellten, die selbst in der kleinsten Filiale auf dem Land anzutreffen sind, unabkömmlich. Da der Online-Kontoauszug nicht funktioniert (den müsste man stets vom selben stationären PC abrufen), darf man ihn persönlich abholen. Das führt im besten Fall dazu, dass alle fünf im Kassenraum anwesenden Angestellte irgendwie in den Prozess – beratend oder aktiv – eingebunden werden. Eine sehr wirksame Art der Arbeitsplatzsicherung.
So respektabel Mario Monti als Person ist und so wohl gemeint seine Taten sein mögen. Im Grunde seines Herzens ist der Wirtschaftsprofessor ein Freund der Banken. Und er tut daher alles, um den Banken seines Landes zu helfen. Dummerweise kommen dabei die Interessen anderer Gesellschaftsgruppen eher zu kurz. Monti kämpft auch darum, die Verkrustungen in der italienischen Gesellschaft zu sprengen. Aber mit wenig Erfolg. Italien wird unverändert von alten Menschen regiert und geprägt, und die denken nicht daran, ihre Macht an Jüngere abzugeben. Junge, talentierte Menschen haben da kaum Chancen – und wandern ab – zum Beispiel in europäische Institutionen. Da zählen Leistungen – und nicht „bella figura“.