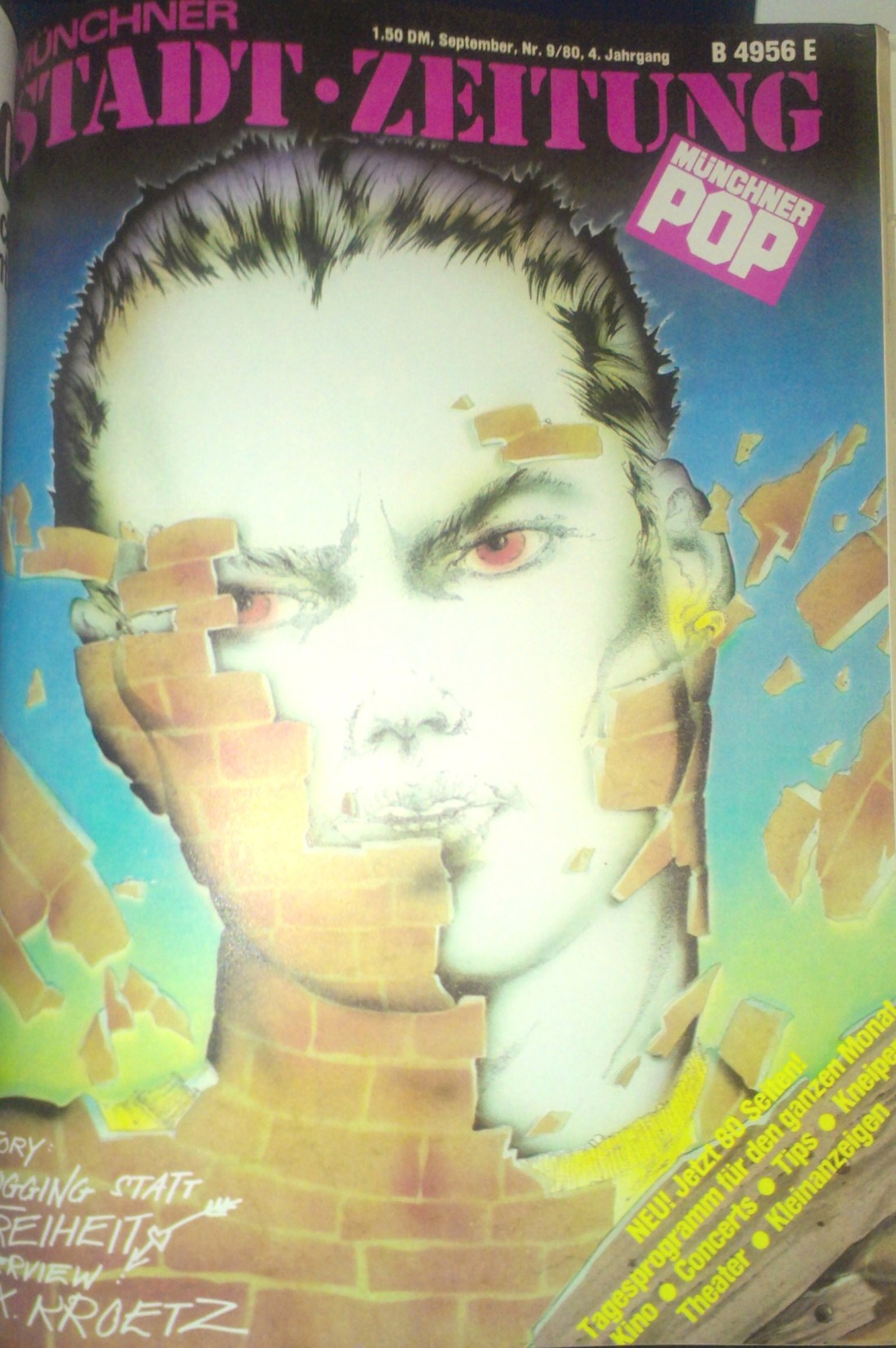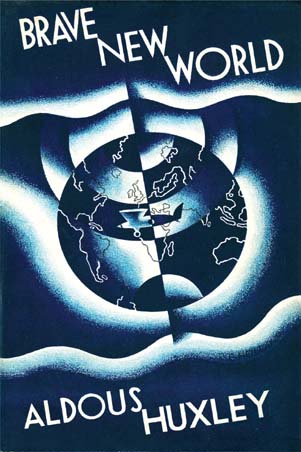Nein zur Winter-Olympiade 2022 in München
Also jetzt keine Olympiade in München. Das Volk wurde befragt und hat es nicht gewollt. Ich hätte schon wollen. Meine Erinnerungen an die Olympiade 1972 waren einfach zu positiv. Das war ein Erweckungserlebnis für die kleine süddeutsche Stadt vor den Alpen. Aus einer zu groß gewordenen Kleinstadt wurde eine Großstadt. Und Flair gab es gratis dazu. Und Sportstätten und eine Infrastruktur, von der wir bis heute hier in München profitieren.
 Aber ich verstehe die Gegner dieses Sportspektakels. Muss ich ja. Zu viele Gegner gibt es in meinem Freundeskreis bis hin zur eigenen Ehefrau. Keine erbitterten Gegner, sondern eher spontane Nein-Sager, die kurz und bestimmt ihr „Jetzt-ist-es-aber-genug!“ zum Ausdruck bringen. Da verfangen bemühte – und zugegebenermaßen oft recht verlogene – rationale Argumente für Olympia kaum: neue Sportstätten, bessere Infrastruktur, mehr Image, mehr Bekanntheit in der Welt, blablabla… Da taten sich die Gegner der Olympiade 2022 in München so viel leichter. Sie hatten verfängliche Argumente: Naturzerstörung, Kommerz, Preissteigerung, Gigantomanismus – und sie wirkten alle gleich auch noch wunderbar emotional. (Doof waren sie oft trotzdem…)
Aber ich verstehe die Gegner dieses Sportspektakels. Muss ich ja. Zu viele Gegner gibt es in meinem Freundeskreis bis hin zur eigenen Ehefrau. Keine erbitterten Gegner, sondern eher spontane Nein-Sager, die kurz und bestimmt ihr „Jetzt-ist-es-aber-genug!“ zum Ausdruck bringen. Da verfangen bemühte – und zugegebenermaßen oft recht verlogene – rationale Argumente für Olympia kaum: neue Sportstätten, bessere Infrastruktur, mehr Image, mehr Bekanntheit in der Welt, blablabla… Da taten sich die Gegner der Olympiade 2022 in München so viel leichter. Sie hatten verfängliche Argumente: Naturzerstörung, Kommerz, Preissteigerung, Gigantomanismus – und sie wirkten alle gleich auch noch wunderbar emotional. (Doof waren sie oft trotzdem…)
IOC, FIFA & Co. sind bäh!
So weit, so gut. Wir könnten wieder zur Tagesordnung übergehen. Dann halt Olympia in Oslo. Denen Olympia zu gönnen tut sich keiner schwer. Die haben sich in einer Volksabstimmung ja nun mal FÜR Olympia entschieden. Aber wer weiß, vielleicht bewirbt sich ja auf den letzten Drücker doch auch noch Katar für die Winterolympiade. Dann wären die beiden Winterereignisse des Jahres 2022 gleich in einer Hand: die Fußball-WM und die Winterolympiade. Das hätte viele Vorteile. Die Kamerateams wären schon vor Ort. Man könnte die Anfangszeiten der Fußball-Spiele und der Winter-Events wunderbar dramaturgisch aufeinander abstimmen. Und Ablaufstörungen bei der Olympiade durch Schneefall, Nebel oder Stürme wären nicht zu erwarten. Und es gäbe kein Problem mit zu wenig Schnee, denn der wäre per se nicht vorhanden…
So absurd solch eine Vorstellung ist. So ganz kann man eine derartige Entwicklung in Anbetracht der Verfassung der maßgeblichen Sportverbände FIFA und IOC nicht ausschließen. Das Nein zur Olympiade in München ist eben auch ein Nein zur gesamten Funktionärsgilde, die heute mit immer neuen Eskapaden durch die Medien geistert. Es ist ein Nein zur schmierigen Biegsamkeit eines – noch dazu deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach. Es ist ein Nein zum alerten und völlig unauthentischen Profi-Funktionär Michael Vesper.
Politik einst und jetzt
Meine so positiven Erinnerungen an eine wunderschöne Zeit zur Olympiade in München schließt ja auch eine breite Begeisterung der Bevölkerung für Olympiade ein. Die haben so seriöse, ernsthafte und authentische Menschen wie ein Sport- und Organisationschef Willi Daume und ein Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel vermittelt. Beide waren Gesinnungstäter für Olympia und für München – und für eine offene Gesellschaft. Bei ihnen war man sich sicher, dass sie im Namen und zum Wohle der Bürger handelten und keine Lobby-Schergen waren. Das Ergebnis war eine Begeisterung quer durch alle Schichten inklusive der Kulturschaffenden und Designer etc.
Und die Politik heute? Die war pflichtbewusst FÜR Olympia. Nur Grüne und die Linke opponierten. Aber wie sah die Unterstützung aus? Bestenfalls pflichtbewusst. In Pflicht nahmen eben Verbände und die Lobby. Vision? Null. Idee? Null. Begeisterung? Kaum wahrnehmbar. Entsprechend hölzern wirkte die Unterstützung und entsprechend krachend hat der abstimmende Souverän den Politikern, die sich zu nichts zu schade sind, die rote Karte gezeigt. Kam hinzu, dass man nach dem pflichtbewusst braven Abstimmungsverhalten für CSU und Merkel zuletzt bei Land- und Bundestagswahlen hier in Bayern mit großer Lust die Chance wahrnahm, es Seehofer & Co. mal wieder richtig zu zeigen. Schließlich ging es diesmal um nichts. Nur um Olympia…
Die Trennung von Politik und Leben
Bezeichnend aber die Reaktion der Befürworter von Olympia und der Politik. Sie waren bass erstaunt über die Niederlage, sie hatten sich tatsächlich in Sicherheit gewogen. Wir müssen nur pflichtschuldig dafür sein und die Sportverbände dazu, dann wird der Bürger schon brav dafür sein. Es scheint kein Sensorium in der Funktionärs- und Politikerkaste mehr zu geben, das Ermüdungserscheinungen und Ekelgefühle gegen einen Sport-Hyperkapitalismus wahrnimmt. Das fällt in den VIP-Logen auch schwer. Dabei wäre ein Blick auf den nun vorbestraften Karl-Heinz Rummenigge und den Steuersünder Uli Hoeneß und auf die laue und maue Fankultur beim dauergewinnenden FC Bayern durchaus lohnenswert. Nicht einmal Stimmungs-Sensibelchen Horst Seehofer scheint da was gemerkt zu haben.
Ach ja, und Franz Beckenbauer, der Alles-möglich-Macher musste diesmal als Werbefrontakteur seine erste Niederlage einstecken. Entsprechend verstockt fiel seine Reaktion darauf aus. Er, der in Katar keine Sklaven in Ketten und Fesseln gesehen hat und daher dort alles in Ordnung fand (siehe Video ab Minute 4:56), ist halt einfach schon viel zu lange in zu vielen internationalen Fußballgremien und -verbänden unterwegs, um noch einen klaren Blick auf Realitäten haben zu können. Denn dann hätte ihm schon mal auffallen müssen, wie inhaltsleer, billig und handwerklich schlecht gemacht die komplette Kampagne „Oja22“ für die Olympiade war. Da war das Zitat des Farbdesigns von Olympia-1972-Designer Otl Aicher eher Hohn.
Der Saturierten-Gürtel Münchens
Dabei wäre es genau darum gegangen, die abstimmenden Bürger für eine neuerliche Olympiade, diesmal im Winter, zu begeistern. Keine leichte Aufgabe, zugegeben. In München gibt es für den sich in seinen Wohlstands-Ritualen schnell gestörten Saturations-Münchner genug Großereignisse und Events. Neuer Höhepunkt 2014: Black Sabbath live auf dem Königsplatz!? Da lehnt man schon fast reflexhaft jede Neuerung und jede vermeintliche neue Irritation ab. Da greift schnell der Saturierten-Narzissmus-Reflex. Du sollst keine (neuen) Helden neben mir haben.
Es ist schon bezeichnend, wenn man sich ansieht, welche Stadtteile Münchens am energischsten gegen die Olympiade gestimmt haben. Nicht die schnöden und mietpreismäßig etwas gemäßigten Stadtteile der Außenbezirke. Die hätten die fünf Ringe gerne in der Stadt gehabt. Es waren die südlichen Stadtteile mit den teuersten Mieten entlang der Isar, in der Innenstadt und in Schwabing, die am energischsten gegen die Olympiade gestimmt haben. Der typische Saturierten-Gürtel der Stadt. Bezeichnenderweise der typische Home-Turf von Münchens Bald-Ex-Bürgermeister Christian Ude.
Den Frieden mit der Ablehnung der Olympiade in München habe ich längst gemacht. Spätestens seit ich in meiner Facebook-Timeline mitbekommen habe, welch ur-anarchistische Freude viele Münchner an der Niederlage der Großkopferten und der politischen Gschwollschädel haben. So gesehen war die Abstimmung der perfekte Anlass, diese Deppen mal so richtig und wirksam zu derblecken. Wie gut das gelungen ist, zeigt die Reaktion der Olympiapromotoren. Sie benehmen sich stilgemäß als beleidigte Leberwürste. Die traurige Diagnose: nichts kapiert. Rein gar nichts. Und genau das ist das Problem…