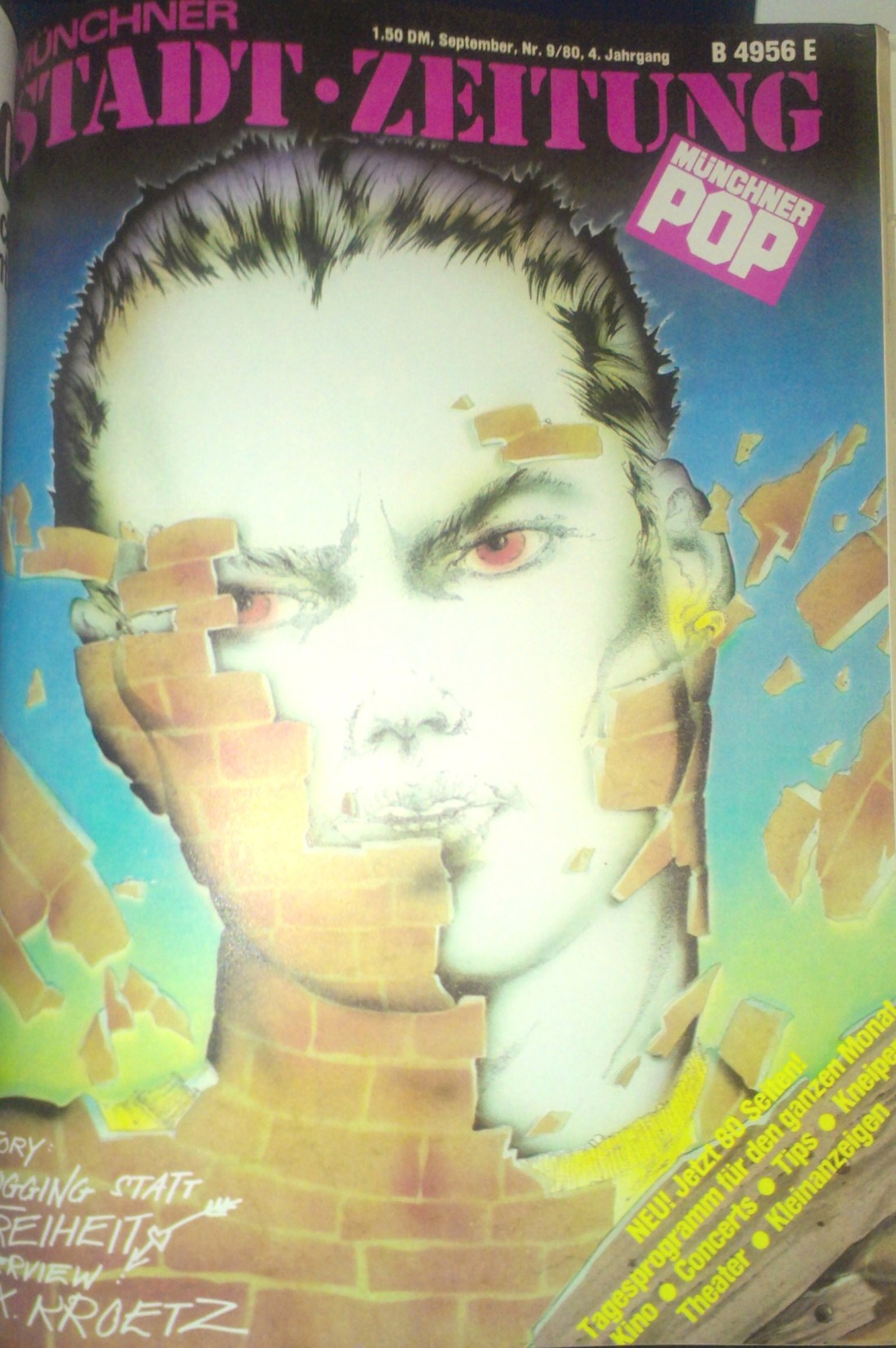Raub der Zukunft
William Gibson, der Doyen der literarischen Cyberwelt, wird gerne mit seinem Bonmot zitiert: „Die Zukunft ist hier. Sie ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt.“ Wie recht er hat, wissen wir in Deutschland nur zu gut. Wir kriegen zur Zeit wirklich nicht viel ab davon. Von der Zukunft, meine ich. Wir sind dazu verurteilt, den Kämpfen um die Beibehaltung der Vergangenheit zuzuschauen, siehe Leistungsschutzrecht oder Vorratsdatenspeicherung und die ganze vor-digitalen Denk- und Verhaltenswelt, die sich darin manifestiert. Wir sind – scheinbar – dazu verurteilt, zuzuschauen, wie wir allen wirtschaftlich schwachen Partnern (!) in der Europäischen Union ihre Zukunft rauben, indem wir ihre fähigsten und vielversprechendsten – jungen – Menschen berauben. Sie sehen zuhause keine Chancen mehr für sich.
 Wir stellen derweil mal ideologische, mal administrative Paravents auf, die uns gefälligst den Blick auf die Zukunft verstellen mögen. Wir wollen nicht zusehen, wie sich die Zukunft um uns herum hurtig verteilt. Vorzugsweise in Asien. Aber immer auch noch in Amerika. Wir kümmern uns lieber um unsere Illusion einer sorgenfreien finanziellen Zukunft. Wir tun so, als würde das Gros der Menschen, die heute Rentenbeträge zahlen, später einmal Rente kassieren können.
Wir stellen derweil mal ideologische, mal administrative Paravents auf, die uns gefälligst den Blick auf die Zukunft verstellen mögen. Wir wollen nicht zusehen, wie sich die Zukunft um uns herum hurtig verteilt. Vorzugsweise in Asien. Aber immer auch noch in Amerika. Wir kümmern uns lieber um unsere Illusion einer sorgenfreien finanziellen Zukunft. Wir tun so, als würde das Gros der Menschen, die heute Rentenbeträge zahlen, später einmal Rente kassieren können.
Unter Mehltau erstarrt
Wir vertrösten unverfroren auf eine bessere Zeit nach allem Stress und Burnout der heutigen Arbeitswelt. Wir sorgen in unserer Medienwelt für notorisch gut gelaunte Radiomoderatoren, für seichte Ablenkung im Fernsehen und hektischen Alarmismus in den News-Medien, um so die wirklich brisanten Themen sorgsam zu kaschieren. Etwa die Frage, wie wir uns in Zukunft selbst definieren mögen? Welche Gesellschaft wir denn wollen, wo sich die derzeitige gerade deutlich an allen Ecken heftig zu ändern beginnt?
Und so steuern wir auf eine Bundestagswahl zu, in der beide Spitzenkandidaten in Person und Programm glaubhaft keinerlei Perspektive und nur ein Wir-werden-unbeirrt-weiter-wursteln verkörpern. Eine Bundestagswahl, in der nach der erfolgreichen Selbst-Vaporisierung der Piraten ein ebenso breites wie amorphes Parteieneinerlei zur Wahl steht, das geschlossen das Thema Zukunft ausgeklammert hat. Ich sehe jedenfalls keine energisch oder gar glaubhaft vorgetragenen Ideen, wie unsere Gesellschaft in fünf oder zehn Jahren aussehen könnte oder sollte.
Verklärung der 50er-Jahre
Im Gegenteil, es wird sorgsam das Weiter-so gepflegt. Ganz so, als könnten wir uns gegen die disruptiven Veränderungen immunisieren, die unseren Gesellschaften in den nächsten Jahren in Technik, Kommunikation, Wirtschaft, Arbeitswelt, Gesundheit, Finanzen, Kultur, Medien und vor allem im sozialen Miteinander (oder eher Gegeneinander) bevorstehen. Wir steuern sehenden Auges in ein neues Zeitalter von einer unter Mehltau erstarrten Gesellschaft. Wenn wir aufwachen, genauer gesagt: unsanft geweckt werden, wird es längst zu spät sein, noch etwas im eigenen Sinn ändern zu können.
Ich bin alt genug, um mich noch – wenn auch nur schemenhaft – an die im Nachktriegstrauma und am Psychopharmakum des Wirtschaftswunders erstarrten Gesellschaft der 50er- und 60er-Jahre zu erinnern. Es war damals nicht schön, auch wenn das Filme, die diese Zeit verkitschen („Madmoiselle Populaire“), so zu verklären versuchen. Die Revolten ab Mitte der 60er-Jahre waren kein Zufall. Ich erinnere mich, wie wir in unserer Klasse immer überrascht waren, wer alles aus unserer Klasse auf Demos anzutreffen war. Da machten sogar die Bravsten mit, und zwar mit Überzeugung.
Die Explosion an Zukunft
Mich erinnert die Zeit heute an diese Stimmung damals zu Beginn der 60er-Jahre. Nur brav stillhalten. Schön fleißig sein. Nicht zu viel wollen. Man war viel zu beschäftigt damit, sich um seinen Wohlstand zu kümmern, um auf „dumme Gedanken“ kommen zu können (zu dürfen). Dabei waren die politischen Diskussionen damals noch weit hitziger als heute, weil die Parteien echte inhaltliche Gräben teilten. Heute erleben wir weite, langweilige Tundra und ideelle Steinwüsten.
Als Gegenmittel lese ich zur Zeit viel Literatur zum Thema Zukunft. Etwa Michio Kaku „Physics of the Future – How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100“. Ein ebenso waghalsiger wie bisweilen fast naiv zukunftsgläubiger Ansatz. Aber bei allem Kopfschütteln an etlichen Stellen, wo er sich mit seiner ungezügelten Zukunftsbegeisterung vielleicht ein wenig vergaloppiert, schildert Michio Kaku wie sich die Welt in den nächsten 20, 50 und 100 Jahren in den Bereichen Computer/Digitalität, (Künstliche) Intelligenz, Medizin, Nanotechnologie, Energietechnologie, Raumfahrt, Wohlstand und menschliches Zusammenleben entwickeln kann – und möglicherweise wird. Als Gerd Gerken und ich Mitte der 90er-Jahre unser Buch „Trends 2025“ nennen wollten, machte der Verlag damals nicht mit, weil die „Leser das ja großteils gar nicht mehr erleben werden“. Das Buch hieß dann „Trends 2015“. (Antiquarisch ist das Buch noch z. B. bei ebay und Amazon erhältlich. – Und es ist immer noch lesenswert…)
Das Ende der Zukunft
Michio Kaku ist für das Thema Zukunft prädestiniert. Er ist einer der prominentesten theoretischen Physiker der USA, u. a. hat er die String- und Quantenfeldtheorie formuliert. Vor allem aber ist er der prominenteste Dokumentarfilmer zum Thema Wissenschaft. Er beschreibt keine seiner möglichen technologischen Entwicklungen ohne nicht in Labors und Forschungsabteilungen Prototypen dafür mit eigenen Augen (und dem der Kamera) gesehen zu haben. Wenn nur ein milder Prozentsatz der prognostizierten Entwicklungen Wirklichkeit wird, sieht unsere Welt sehr bald sehr viel anders aus als heute. Oder salopp formuliert: Dann ist die Welt einer Angela Merkel (eine Physikerin!) oder eines Peer Steinbrück ganz schnell Geschichte. Und zwar eine, die sehr alt aussieht.
Diese Zukunft wird sehr schnell kommen und nicht mehr in technologischen Schüben wie zuletzt das Internet. Sie wird kontinuierlich und immer schneller immer drastischere Veränderungen bringen. So schnell und pausenlos, dass der amerikanische Medientheoretiker und Vortrags-Kapriolist Douglas Rushkoff in seinem neuesten Buch „Present Shock“ ein Ende der Zukunft prognostiziert. Alles entwickelt sich in seiner Sicht so schnell und passiert so zeitgleich, dass das linerare Bild der Zukunft als Zeitstrahl aus der Gegenwart in ein Jenseits nicht mehr funktioniert.
Die permanente Gegenwart
Rushkoffs relativ steile These ist die, dass die Zukunft ausgedient hat, weil sie in der Gegenwart angekommen ist. Statt auf eine (bessere?) Zukunft zu warten, leben wir in einer sich ständig wandelnden Gegenwart. Statt große Pläne für die Zukunft schmieden zu können, sind wir mehr als gut damit beschäftigt, uns durch die komplexen, miteinander verflochtenen allgegenwärtigen Probleme zu arbeiten und sie graduell zu verbessern, ohne noch die Hoffnung auf eine grundlegende Lösung haben zu dürfen: die Bevölkerungssituation, die Finanzkrisen, globale Erwärmung, Terrorismus, Ernährungssituation etc.
Das setzt dem alten Bild der Politik als Heilsversprecher und Problemlöser ein Ende. Statt Anfang und Ende von Projekten, statt abgeschlossener Kapitel erleben wir in Rushkoffs Sicht die Realität künftig als nicht enden wollendes Computerspiel, in dem es kontinuierlich neue Aufgaben zu lösen gibt, ohne je aufhören zu können und durch einen neuen Spiellevel erlöst zu werden. Er ist in seinem Denken da ganz nah an Zygmunt Bauman und seiner Idee der „Liquid Modernity“. Alles ist permanent im Fluss, es geht immer weiter, ohne Einschnitte, Höhepunkte und alle Erlösungselemente. Nicht: Alles wird gut! Sondern: Alles ist im Fluss.
Ohne Erlösungselemente, nur im Hier und Jetzt. Das heißt in seiner Konsequenz Abschied nehmen von Hoffnungen einer Post-Arbeits-Idylle, die heute Rente heißt. Das heißt eine permanente, ja sich beschleunigende Innovationsverpflichtung. Das heißt Abschied nehmen von der Idee von Lösungen. Das heißt ein permanentes Nachjustieren. Das heißt in seiner Beschleunigungsdynamik ein stetiges Arbeiten mit möglichst disruptiven Entwicklungen. – Die Durchwurstel-Metapher, die würde einer Angela Merkel ja perfekt liegen. Aber auf Innovation oder gar – CDU/CSU/SPD/FDP/Grüne bewahre – Disruption ist bei ihr sicher nicht zu hoffen. Und bei Peer Steinbrück ebenso wenig. Mit ihnen werden wir bei der Verteilung mit Zukunft auf alle Fälle zu kurz kommen.
Ein Kuriosum als Nachtrag: Douglas Rushkoff nennt sich in Abgrenzung zu den Futuristen „Präsentist“. Den Ausdruck gibt es schon in Deutschland. Er bezeichnet Menschen, die nie in der Arbeit fehlen, egal wie krank oder ausgebrannt sie sind…