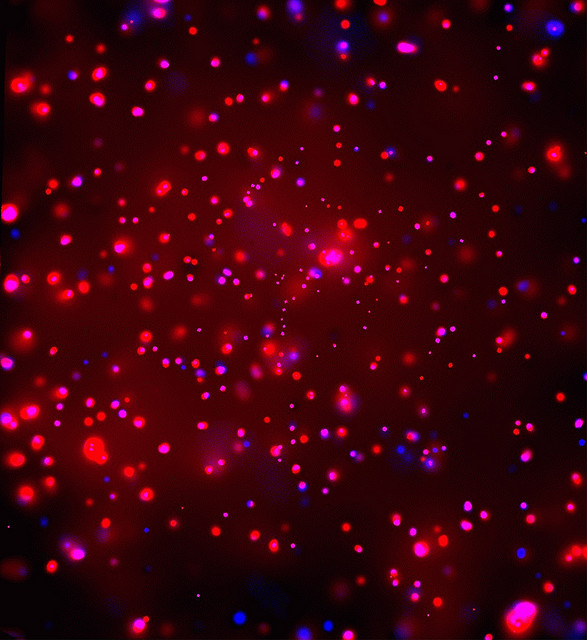Das Paradox des segenreichen Verlusts von Materie
Die beeindruckendste Schallplattensammlung habe ich einst in der Wohnung von Musikjournalismus-Legende Ingeborg Schober († 2010) zu sehen bekommen. Ein Zimmer voller Platten, alle vier Wände voll – und in den angrenzenden Zimmern in der Schwabinger Wohnung noch mehr. Bei mir nahm die Schallplattensammlung nur eine halbe Wohnzimmerwand ein, dafür reichte sie in meiner Haidhauser Altbauwohnung bis zur Decke und versammelte ca. 8.000 Alben. Heute verstauben meine ca. 2.000 CDs in einem Schubladenschrank, denn all meine Lieblingsmusik ruht längst digitalisiert auf Festplatte und PC. Aktuell aber höre ich fast ausschließlich Musik, die ich physikalisch nicht besitze. Ich bin Abonnent bei Spotify. Hier habe ich Zugriff auf Millionen von Musiktiteln.
 Bei Spotify kann ich jetzt problemlos Ingeborg Schobers These nachprüfen, „Soon Over Baluma“, das Album, das Can 1974 veröffentlicht hat, sei vielleicht erst 2014 zu verstehen. So hat sie es einst in einer Rezension formuliert. – Ingeborg hat nur bedingt recht: Wer sein Ohr nicht ausreichend mit Jazz und Weltmusik trainiert hat, wird auch 2014 ratlos bleiben.
Bei Spotify kann ich jetzt problemlos Ingeborg Schobers These nachprüfen, „Soon Over Baluma“, das Album, das Can 1974 veröffentlicht hat, sei vielleicht erst 2014 zu verstehen. So hat sie es einst in einer Rezension formuliert. – Ingeborg hat nur bedingt recht: Wer sein Ohr nicht ausreichend mit Jazz und Weltmusik trainiert hat, wird auch 2014 ratlos bleiben.
Der virtuelle Sammler
Spotify macht solche Hör-Abenteuer möglich, die man bis jetzt aus Kostengründen und wegen Beschaffungsstress gemieden hat. Es öffnet völlig neue Hörgefilde – und liefert dabei auch fast alle lieb gewonnenen Songs und Sounds. Dass ein paar Bands wie Led Zeppelin oder Metallica sich noch verweigern, geschenkt. (Kurioserweise sind alle LedZep-Mitglieder mit ihren Soloprojekten auf Spotify.)
Fakt ist, meine Leidenschaft, die unterschiedlichsten Arten von Musik zu hören, ist ungebrochen. Das war einst nur durch den Kauf von Unmengen von Platten und später CDs möglich. Dementsprechend galt ich seit dem Kauf meiner ersten Single „See my Friends“ von den Kinks 1965 als Plattensammler. Aber seit der Verbreitung von MP3 Files hat sich meine Sammler-Leidenschaft schwer virtualisiert und dematerialisiert. Ich wundere mich selbst, wie wenig es mir ausmacht, Musik nicht mehr zu besitzen. Es reicht die Verfügbarkeit, wie sie Spotify bietet. Und so viel mehr an Musik und Klanggemälden dazu.
Wer soll das bezahlen?
Der absurde Nebeneffekt ist, dass das alles so viel billiger kommt. 10 Euro pro Monat kostet das Premium-Paket. (Die Basis-Version mit minderer – aber akzeptabler – Soundqualität und Werbung ist gratis.) Das ist atemberaubend weniger Geld als ich bisher für den regelmäßigen Nachschub an Musik per Download pro Monat bezahlt habe. Und es ist bequemer. Die Playlists sind leichter zu verwalten – und vor allem kann man sich jetzt mit seinen Freunden (zumindest denen auf Facebook) über seine Hörleidenschaften austauschen. Musikalisch gesehen ist jetzt jeder Tag als würde Weihnachten, Ostern und Geburtstag auf einen Tag zusammenfallen.
Trotzdem darf man bei Spotify ein gutes Gewissen haben, denn für jeden gespielten Titel geht Geld an diejenigen, die die Rechte an dem Song halten. (Nicht immer sind das die Musiker, die die Musik geschaffen haben.) Aber das können bei den geringen Abo-Summen und der Über-Masse der abgehörten Titel nur Nano-Beträge sein, die sich nur bedingt akkumulieren. Noch funktioniert Spotify wie einst das Gratisanhören im Plattenladen: Man kauft dann doch Platten, die man dort entdeckt und die einem wichtig erscheinen. Noch tut man das. Das wird in ein paar Jahren, wenn man sich an die Convenience und die Vorzüge dematerialisierten Hörens gewöhnt hat, anders werden.
Die Zukunft der Pflichtmedien
Das Musikbusiness ist hier der Vorreiter. Wahrscheinlich, weil die Musik als erstes Medium die komplette Umwandlung ins Digitale vollzog, als die CD eingeführt wurde. Als Nächstes werden die Print-Medien samt Buch folgen. Die E-books kommen unaufhaltsam, sie sind zu bequem und mobil gut nutzbar – und billiger sind sie auch überall dort, wo es keine Buchpreisbindung wie in Deutschland gibt. Spannend wird, ob sich hier Kiosk-Modelle mit Einzelbezahlung durchsetzen werden. Ich vermute, eher nicht. Ein All-for-wenig-Geld-Abomodell wie Spotify ist aber für Print-Medien nur schwer vorstellbar. Höchstens, wenn sie sich Kultur-Flatrate nennt und staatlicherseits ähnlich rigide umgesetzt wird wie die Pflichtsteuer für die öffentlich-rechtlichen Sender (Hörfunk & TV).
Der Weg zur De-Materialisierung, zum Abschied von materiellem Besitz, wird sich aber unbeirrbar fortsetzen. Alle Waren, die es im Überfluss gibt, und die so zur Commodity, zur Selbstverständlichkeit werden, wird man immer weniger „besitzen“ wollen, sondern einfach zur freien Verfügung haben wollen. Das betrifft nicht nur Medien und Kulturgüter wie Musik, Filme, Texte, Kunst (auch die kann man längst leihen), sondern auch Maschinen, inklusive Automobile, Waschmaschinen, Kaffeemaschinen etc. Die Selbstverständlichkeit, wie wir uns heute teure Smartphones von unseren Carriern „schenken“ lassen, um die Kosten dann mit teurer Nutzung abzubezahlen, wird sich auch auf andere Branchen ausbreiten. Der Elektrocar-Betreiber „Better Place“ (Israel, Dänemark, Kalifornien) von Shai Agassi (Ex-SAP) hält es heute schon für möglich, seine Autos zu verschenken, um dann die Kosten über Nutzungsgebühren für die Batterien zu refinanzieren.
Die Ent-Materialisierung von Geld
Die gesamte Debatte über geistiges Eigentum, Urheberrecht und die dafür fehlenden Businessmodelle in einer digitalen Welt der Zukunft bekommt in der Perspektive einer Ent-Materialisierung ganz neue Aspekte. Wir werden uns an ganz neue Finanzierungsmodelle gewöhnen, die unser Monatsbudget in der Summe letztlich nicht weniger belasten werden als heute unsere Kauf-Gewohnheiten. Aber sie werden „stiller“ sein, so wie heute unsere Rechnung fürs Handy. Dafür werden nicht zuletzt die digitalen Powerhouses wie Facebook, Google, Amazon, Apple oder Microsoft sorgen, die gerade jeder für sich eigene digitale Zahlungsmöglichkeiten entwickeln – und anfangen sie uns schmackhaft zu machen. Und die bisherigen Zahlungs-Platzhirsche wie Visa, Mastercard, American Express und die Banken mit ihren Karten wehren sich mit eigenen digitalen Bezahlungs-Techniken.
Egal wie der erwartbare Mega-Clash der alten und neuen Bezahl-Mogule ausgehen wird – und das wird spannend werden! – danach wird das reale Geld aus Scheinen und Münzen weitgehend ausgedient haben. Es wird eine ähnlich nostalgische Rolle spielen wie heute der Hinweis: „Bei uns kann man noch mit der guten alten D-Mark bezahlen.“ Bezahlt wird künftig mit dem Handy, mit intelligenten NFC-Chips oder was auch immer einen Konsumenten digital eindeutig identifizieren kann. So wird auch das Geld de-materialisiert – und nur noch still und diskret abgebucht werden.
Und so wird man digital durchaus noch materielle Dinge kaufen. Aber nur noch rare und spezielle, die einem einen Mehrwert bieten – in der individuellen Ausformung der Persönlichkeit, in der Abgrenzung zu anderen und in einer wie auch immer gearteten Besitz-Obsession. Das werden Fetische sein, die einem sein Ich verschönen. Dinge, die den jeweils aktuellen Luxus darstellen. (Das können dann auch – selten gewordene – Print-Magazine sein.) Das werden Produkte sein, die einem ganz besondere Geschichten erzählen (die man dann weitererzählen kann). Das werden Verrücktheiten sein, die einen von anderen abgrenzen und einem in ihrer Skurrilität diebische Freude bereiten werden: Zum Beispiel der Besitz von Vintage-Datenträgern aus Vinyl, die man im 20. Jahrhundert Langspielplatten nannte.