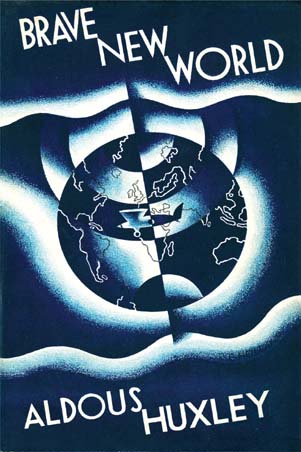Angst vor der eigenen Schöpfung
Man sollte eher gut drauf sein. Nur dann macht es Sinn, sich die Liste der 50 eindrucksvollsten dystopischen Filme zu Gemüte zu führen. Ich bin erschrocken, wie viele dieser zukunftspessimistischen Filme davon zu meinen Lieblingsfilmen gehören und wie sehr einige davon mein Denken geprägt haben. Von den Top 10 habe ich fast alle gesehen – und schätze sie alle (einige mehr, andere weniger):
- Metropolis
- Clockwork Orange
- Brazil
- Wings of desire (Engel über Berlin)
- Blade Runner
- Children of Men
- The Matrix
- Mad Max 2
- Minority Report
- Delicatessen
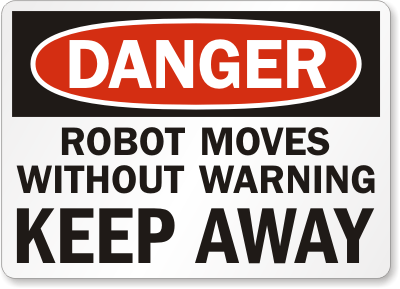 Der größte gemeinsame Nenner dieser 50 Dystopien ist, dass in den meisten von ihnen künstliche Wesen ihr Unwesen treiben. Cyborgs, Replikanten, Roboter oder andere künstliche Menschenwesen. Die zweite Schöpfungsgeschichte sozusagen: Die Menschen schufen Wesen nach ihrem Ebenbilde. Und wie wir, bzw. Adam und Eva, wollen auch die künstlichen Wesen vom Baum der Erkenntnis naschen – und wenden sich so gegen ihre Schöpfer.
Der größte gemeinsame Nenner dieser 50 Dystopien ist, dass in den meisten von ihnen künstliche Wesen ihr Unwesen treiben. Cyborgs, Replikanten, Roboter oder andere künstliche Menschenwesen. Die zweite Schöpfungsgeschichte sozusagen: Die Menschen schufen Wesen nach ihrem Ebenbilde. Und wie wir, bzw. Adam und Eva, wollen auch die künstlichen Wesen vom Baum der Erkenntnis naschen – und wenden sich so gegen ihre Schöpfer.
Diese absurde Angst vor der Schöpferrolle des Menschen! Wir schaffen Wesen nach unserem Vorbild – und diese wenden sich dann gegen uns und übernehmen die Macht. Mal keck weitergedacht: Spiegelt sich hier unsere Angst, unserem Schöpfer könnte es einst genauso gegangen sein?
Sind uns Roboter überlegen?
Entsprechend negativ ist über all die Jahre die Rezeption der Idee des Roboters und des brav funktionierenden Humanoiden. Vielleicht weil er in seiner maschinenhaften Effizienz uns Menschen vor Augen führt, wie maschinenhaft viele unserer Arbeiten sind – und wie wenig wir dafür mit all unserer menschlichen Beschränktheit an Kraft und repetitiver Präzision geeignet sind.
Bisher konnte man sich gegenüber der Maschinen-Konkurrenz relativ in Sicherheit wiegen. Das war eine Zukunft, die ganz weit weg war. Was sich dann doch einmal bis in die Medien vorgekämpft hatte, das waren drollig aussehende, dem Kindchen-Schema brav entsprechende Prototypen, die eigentlich nur Maschinen-Intelligenz und Praktikabilität simulierten. Letztendlich waren sie alle zu nichts Vernünftigem zu gebrauchen. Bei mir im Keller verstaubt auch noch ein Sony Aibo, der kleine Roboter-Hund, der trotz sorgfältiger Pflege kaum etwas vom versprochenen Lerneffekt zeigte und nur sehr erratisch herumtapste. Was er prima konnte: im Weg rumstehen – und virtuell das Beinchen heben.
Outsorcing an Automaten und Roboter
Plötzlich aber ist es mit dieser Automaten-Idylle vorbei. Roboter sind allenthalben in den Schlagzeilen: Drohnen erledigen schmutziges Kriegsgeschäft in Pakistan. Sie liefern im Auftrag von Amazon oder DHL frei Haus. (Wo bitte, wollen die landen?) Als Quadropter drohen sie vor dem eigenen Schlafzimmerfenster als Flying Peeping Tom herum zu schwirren. In den USA fahren schon mehrere Auto-Flotten ohne jede Intervention von (menschlichen) Fahrern durch die Städte. In den Gärten sorgen Rasenmäher-Roboter für akkurate Rasenlängen. Und es gibt sogar Fensterputz-Roboter.
Noch sind die Geräte wenig überzeugend, verteilen den Schmutz mehr, als sie ihn beseitigen. Aber das sind Kinderkrankheiten. Denn die Roboter sind gnadenlose Nutznießer von Moore’s Law. Ihre Rechnerleistung verdoppelt sich alle 12 bis 24 Monate. Sie denken immer schneller, bisweilen auch immer besser. Unsere produzierende Industrie wäre ohne klaglos arbeitende (Industrie-)Roboter längst nicht mehr konkurrenzfähig. Unsere Autos wären immer noch so unpräzise produziert wie einst vor 20 Jahren. (Nein. Früher war nicht alles besser!) Unsere Chips wären nicht so leistungsfähig und klein. Und unsere Smartphones wären immer noch so unhandlich wie Ziegelsteine.
Die Job-Killer aus der Retorte
Die Roboter sind längst die Garanten unserer Produktivitäts-Steigerungsraten, die unser kapitalistisches System so dringend braucht. Und diese Roboter vernichten dabei stets massenweise Arbeitsplätze. Aber seit den Maschinenstürmern Anfang des 19. Jahrhunderts kam es eigentlich nicht mehr zu rassistischen Ausfällen gegenüber Robotern. Und Widerstand gegen Replikanten gab es bislang nur in Science-Fiction-Filmen (siehe oben).
Schon gibt es Ideen, im Zuge der Evaporisierung von (bezahlter) Arbeit so etwas wie eine Produktivitäts- oder Maschinen-Steuer einzuführen. Eine scheinbar logische Idee, wenn arbeitende Menschen mangels Arbeit als Steuerzahler wegfallen, dann halt ihre Surrogate, die Roboter, die das Gros der Arbeit machen, Steuern zahlen zu lassen. Fragt sich, wann die Androiden & Co. so menschenähnlich werden, dass sie auch Kreativität entwickeln, wie sie Steuern sparen – oder hinterziehen können. Das wäre der ultimative Turing-Test: Können Roboter so intelligent werden wie wir Menschen? Oder wie wir uns fälschlich dafür halten…
Die Umkehrung des Turing-Tests
Während wir uns noch in hyper-replikanter Hybris in intellektueller Sicherheit wiegen, laufen längst die umgekehrten Tests der intelligenten Maschinen mit uns. Funktionieren wir brav so, wie es die Maschinen wollen – und merken es selbst nicht. Wir schreiben brav die CAPTCHA-Texte ab, wenn wir Formulare im Web ausfüllen. Die – vermeintlich – intelligenteren Menschen unter uns, meinen damit etwas Gutes zu tun, nämlich unentgeltlich die Digitalisierung von Büchern durch Google mit menschlichem Wissen zu optimieren. In Wahrheit ist das der perfekte Test der Maschinen, ob wir nicht eine von ihnen sind, bzw. „nur“ brave, sich den Maschinen überlegen fühlende Hominiden.
Die These ist Ihnen ein wenig zu steil? Mehr Beispiele gefällig? Amazon’s Mechanical Turk, die Angebots-Plattform für Billigstlohn-Arbeiten, ist die optimale Clearingstelle der Maschinen-Intelligenz, auf welchen monetären Wert sich menschliche Arbeit herunterhandeln lässt, um noch mit Maschinen-Effizienz und Algorithmus-Präzision mithalten zu können. 1 Cent (US) pro URL, 2 Cent pro ausgefülltem Adressformular, 11 Cent für das Tagging eines „Adult Movie“, das gibt es hier zu verdienen. Das summiert sich – eben nicht. Ach ja, 1 Cent gibt es auch pro ausgefülltem CAPTCHA.
Barrierefreies Lernen für Maschinen
Ein Problem hat die Maschinen-Intelligenz. Sie braucht Stoff. Digitalen Stoff. Denn wie soll sie sonst lernen? Je mehr digitale Daten, desto besser kann sie ihre Schlüsse aus unseren Erfolgen und Misserfolgen ziehen. Und wir liefern brav. Die Bibliothek unseres Wissens macht Google gerade maschinenlesbar. (Für die Fehlerfreiheit sorgen wir Menschen – mittels CAPTCHA.) All unser Leben, all unser Denken wird immer digitaler, dank Social Media, Netzwerken und Kommunikationssystemen. Damit die Maschinen vollen Zugang darauf bekommen- und wir keine abgekapselten Inseln des Wissens mehr haben, haben die NSA (National Security Agency) und die mit ihnen kooperierenden oder konkurrierenden Geheimdienste alle Barrieren, einst Datenschutz genannt, aufgehoben. Sie ermöglichen der Maschinen-Intelligenz jetzt endlich barrierefreies Lernen.
Und damit auch nichts aus dem Datenuniversum, das wir gerade zu explosionsartiger Ausdehnung bringen, verloren geht, baut die US-Regierung in der Wüste den größtmöglichen Datenspeicher mit dem vorläufigen Fassungsvermögen von mindestens zwei kompletten Jahrgängen an Datenvolumen. Da werden die Konkurrenten China, Russland etc. nicht Ruhe geben und ihrerseits Ähnliches schaffen. Die funktionieren für das Maschinen-Lernen prima als nötigen Sicherheits-Speicher und Parallel-Rechner. – „Warning! Keep away! Robot moves without warning!“