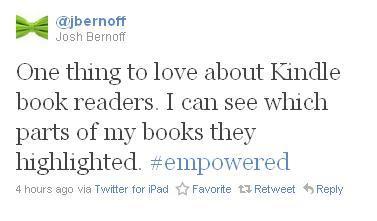Angst vor der geistigen Entgrenzung
Es gibt seltsame Wochen, da scheint eine (eher unerhebliche) Meldung auf wundervolle Weise mit anderen ein unerwartetes Sinngeflecht zu spinnen. Das ist ähnlich, wie wenn man des Nachts wild durch die Vielfalt digitaler TV-Kanäle zappt und auf kuriose Weise ein Film in einem anderen, einem (oder mehreren) Videos oder sogar Talkrunden eine Spiegelung, Ergänzung oder Kommentierung erfährt. Eine liebenswerte Selbsttäuschung unseres Bewusstseins, wenn es sich auf ein bestimmtes Thema kapriziert, möglichst viel darunter subsummieren zu wollen.

Manchmal entsteht aber solch eine thematische Assoziationskette auch in den Medien und den sie kommentierenden Sozialen Netzwerken. Am Anfang stand die Meldung, dass uns Google vergesslicher, wenn nicht dümmer macht, weil sich Studenten, die wussten, dass Fakten in Google gespeichert waren, weniger Informationen merkten als eine Kontrollgruppe, die das nicht wusste, so eine Harvard-Studie. Kein neues Thema, da gibt es schon Bücher zu, aber jetzt war die These endlich wissenschaftlich belegt, so hieß es. Der erste Medienreflex ist dann das übliche Google-Bashing: Spiegel Online titelt: „Internet macht vergesslich“. Zitat: „Unser Gehirn lernt immer mehr, nicht zu lernen.“ Und Google, Bing und Wikipedia sind schuld.
Hätten Sie’s gewusst?
Solch eine Lernste-was-biste-was-Logik erinnert mich an meine Eltern, die mich immer mit dem Argument ermuntert haben, Quiz-Sendungen wie „Hätten Sie’s gewusst“ (Heinz Maegerlein), „Einer wird gewinnen -EWG“ (Hans-Joachim Kulenkampff) oder „Der große Preis“ (Wim Thoelke) anzusehen, man würde dadurch klüger. Wahrscheinlich muss solch Argumentation noch heute herhalten, wenn unbedingt „Wer wird Millionär“ (Günther Jauch) angesehen wird oder suchtartig Sudoku-Rätsel gelöst werden. Die Wahrheit ist brutal: Auf diese Weise wird man nicht klüger, man belastet sein Hirn nur mit unnützem Spezialwissen. (Und dass durch den Konsum von TV-Sendungen die Hirntätigkeit wirksam gegen Null gefahren wird, das ist auch etliche Male wissenschaftlich nachgewiesen worden.)
Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Google macht uns nicht dümmer, sondern macht unser Hirn frei für Wichtigeres und Effektiveres als das Speichern (heute immer schneller vergänglicher) Fakten. Diese Tatsache hat dann doch auch tatsächlich die taz erkannt und sogar Frank Schirrmacher in FAZ.net hat sie erahnt. Auf den Punkt aber brachte die Diskussion Douglas Coupland (Generation X, Generation A) im Guardian: „Let’s face it, Google isn’t making us stupider, it’s simply making us realise that omniscience is actually slightly boring.“ Google macht nicht dümmer, es hilft uns nur zu kapieren, dass Allwissenheit ein bisschen langweilig ist.
Allwissen tut weh
Wie sehr Allwissen nerven kann, dazu wird in der Augustausgabe des Wired (US) der Technologie-Kritiker Erik Davis zitiert, den es stört, wie im Internet alles bewertet, kommentiert, mit Sternchen zu belohnt wird oder mit Daumen nach oben ge-liket wird : „Our culture is afflicted with knowingness. We exalt in being able to know as much as possible. (…) But we’re forgetting the pleasures of not knowing. (…) We have started replacing actual experience with someone else’s already digested knowledge.“ Unsere Kultur leidet unter notorischer Wisserei. Wir gefallen uns allzu sehr darin so viel wie möglich zu wissen. Aber wir vergessen dabei, wie angenehm es sein kann, etwas nicht zu wissen. – Wir tendieren dazu, echtes Erleben durch das erlebte Wissen anderer zu ersetzen.
Der Autor des Artikels, Chris Colin, beschreibt die Schönheit neuer Entdeckung von Altbekanntem: „It’s a fundamental bit of humaness to discover, say, the Velvet Underground for the first time – to reach at 13 an unbiaased and wholly personal verdict on those strange sounds.“ Es ist fundamental für ein Menschsein, etwa Velvet Underground heute neu zu entdecken, und etwa als 13-jähriger ein völlig neues, unbefangenes Urteil über diese schrägen Sounds zu fällen. –
Erfahrungen ohne Meinungsvorgaben
Genau darum geht es doch, dass immer neue Erfahrungen gemacht werden. Gerade die Generation der Jungen muss ihre eigene Sicht auf Dinge entwickeln, auch auf historische Klänge wie Velvet Underground oder Jimi Hendrix – genauso wie die älteren Generationen Lady Gaga oder Usher zu genießen lernen müssen. Das ist das Wesen der Evolution, dass immer neue Variationen entwickelt werden. Nur so kann Innovation entstehen und nur so kann für die je aktuelle Zeit die richtige Einstellung gefunden werden, können neue, passendere Lösungen gefunden werden – oder wirklich provokante Innovationen. Je kritischer, instabiler und unübersichtlicher die Zeiten werden, desto notwendiger wird eine riesige Bandbreite an möglichen Ideen. Und die entwickelt sich nicht aus Bewertungssystemen und Empfehlungsalgorithmen eines breiten Massengeschmacks.
Einer der größten – und erfolgreichsten Querdenker und kulturellen Innovatoren ist Brian Eno. Er hat nicht nur erfolgreich Musik produziert (Roxy Music, Talking Heads, U2, Coldplay u.v.a.), sondern hat mit seinen Musikexperimenten immer wieder Neuland betreten, dem dann viele andere folgten. Sein neuestes Album heißt “Drums Between the Bells” und ist Klang gewordene Poesie und Sprache.
Selbstveränderung und Selbstmodifikation
In einem Interview zum Album formuliert Brian Eno in der New York Times auf wunderschöne Weise eine fundierte, evolutionäre Vision einer positiven Zukunft: “Something I’ve realized lately, to my shock, is that I am an optimist, in that I think humans are almost infinitely capable of self-change and self-modification, and that we really can build the future that we want if we’re smart about it.” Ich habe für mich entdeckt, und das war ein Schock, dass ich ein Optimist bin. Ich glaube daran, dass Menschen unendlich talentiert sind zur Selbstveränderung und Selbstmodifikation. So können wir wirklich die Zukunft schaffen, die wir uns wünschen, wenn wir es nur schlau anstellen.
Und die Plattform für diese Entwicklung ist das Internet samt Google, Facebook, Wikipedia – und was noch alles kommen wird. Das Internet macht nicht dumm, nicht vergesslich. Es schafft nur den Platz, indem es Faktengerümpel aus unseren Gehirnen entfernt, für unsere Selbstmodifikationen, unsere Selbstveränderung – als Individuen, als Gesellschaft, als Menschheit. Und am Schluss kommt es auch gar nicht so sehr an, was das Internet mit unserem Gehirn tut. „Look at what these media are doing to our souls.“, zitiert Douglas Coupland Marshall McLuhan: Passt auf, was diese Medien mit euren Seelen machen! Mit den Seelen des Homo post-sapiens.