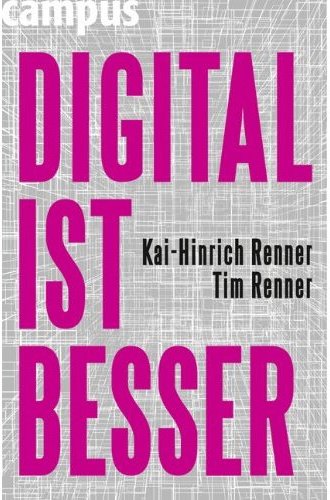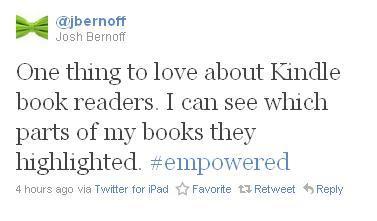Westerwelle vs. Guttenberg
Guido Westerwelle ist das exakte Gegenstück zu Karl Theodor zu Guttenberg. So wie Kain und Abel, Yin und Yang, Gelb zu Blau. So hat Guido Westerwelle seine Doktorarbeit glaubwürdig selbst geschrieben. Zum einen gab es damals noch kein Internet und da hätte Abschreiben schon mal richtig Arbeit gemacht. Zudem hat er ein Thema gewählt, bei dem (nur) er sich wirklich auskannte: „Das Parteienrecht und die politischen Jugendorganisationen.“ In der Jugendorganisation der FDP war er wirklich Experte, war er doch „Mitbegründer der Jungen Liberalen“ (Zitat Wikipedia) und fünf Jahre lang deren Bundesvorsitzender. Außerdem besticht die Doktorarbeit durch eine dem öden Thema angemessene inhaltliche Zurückhaltung. Und nach 140 Seiten ist man auch schon mit dem Thema durch. Guttenberg brachte es auf immerhin ambitionierte 400 Seiten ausgeliehener Textbausteine.

Aber hier fangen die Unterschiede zwischen Westerwelle und Guttenberg erst an. Man muss den beiden nur einmal bei ihren Reden zuhören; man ist an dekadent-römische Zeiten erinnert: Hier der Volkstribun, der seine Kritik in einer stets besserwisserischen Pose ätzt, dort das Mitglied des Hochadels, der sich nie in den Niederungen der Opposition aufgehalten hat und so eine sorgfältig im Zaum gehaltene Souveränität auf Gutsherrenart virtuos beherrscht. Man braucht gar nicht zu ätzen, denn man weiß sowieso alles besser. Per se, versteht sich.
So verschieden Attitüde und Tonalität von Guttenberg und Westerwelle sind, so ähnlich sind ihre Wurzeln. Beide sind Söhne alleinerziehender Väter. Beide lieben Oper (Bayreuth), aber auch Zeitgenössisches. Guttenberg geht zu AC/DC, mag „Rock, House und Soul“ (Zitat auf Facebook), Westerwelle liebt „Pop und Charts“ (notiert er auf Facebook). Damit hat es sich aber wohl mit den Gemeinsamkeiten. Denn sowohl in ihrem Auftreten wie in der Rezeption durch die Menschen unterscheiden sie sich elementar.
Schwarze Projektionsfläche
Wir hatten zuhause eine Projektionsleinwand, die sorgfältig zusammen gerollt auf das eine Mal im Jahr wartete, dass der Diaprojektor ihm Bilder von den Reisen in den Süden darauf warf. Meist waren es Bilder aus Italien, aber dann auch schon mal Spanien, Jugoslawien – die älteren unter den Lesern mögen sich erinnern – oder Marokko. Diese „Leinwand“ war in Wahrheit ein mit einer speziellen Kristallfolie überzogener schwarzer Stoff. Nach vorne wurden strahlende, brillante Bilder abgestrahlt, umgekehrt aber war die Bildwand schwarz und schluckte jedes noch so schöne Bild, das ein Projektor auf sie warf.
Welch passendes Bild für das ungleiche Paar Westerwelle und Guttenberg. Der eine, Guttenberg, war die strahlende, geschliffene, brillantine-gegelte Projektionsfläche für alle Hoffnungen breitester Bevölkerungskreise nach einem unabhängigen, intelligenten, durchsetzungsstarken Kopf, der davon möglichst nur in homöopathischen Dosen Gebrauch machen sollte. Und wenn, dann nur bei mehrheitsverdächtigen Themen wie etwa der Abschaffung der Wehrpflicht. In der Verklärung von Guttenberg als Kanzler in spe kanalisierten sämtliche Irrationalismen der politischen Mitte – und rechts davon – bis hin zu einem verkappten Monarchismus und dessen kinotauglicher Strahlkraft.
Genau umgekehrt Guido Westerwelle. Er hat es geschafft, in knapp 15 Monaten zur Projektionsfläche allen Ärgers, allen (politischen) Versagens und aller Befürchtungen zu werden, die die breite Öffentlichkeit gegen Politiker seit je her hegt. Er ist wie die Rückseite unserer Familienleinwand von einst. Es ist stets nur tiefstes Schwarz zu sehen, sei es, es wird wirklich Düsternis und Versagen gezeigt oder möglicherweise auch einmal Licht. Manchmal mag man meinen, dass Westerwelle in dieser Negativ-Projektion Unrecht geschieht. Dann aber stärkt er mit entsprechenden Aktionen oder wahlweise saloppen oder hohlen Sprüchen regelmäßig die Befürchtung, dass es nicht an der Projektion der Massen, sondern an den von Westerwelle produzierten und präsentierten Inhalten liegt, dass sein Image so schlecht ist.
Der Hahnenkampf um Libyen
Es ist ewig schade, dass wir den Hahnenkampf zwischen einem Verteidigungsminister Guttenberg und dem Außenminister Westerwelle zur Libyen-Frage nicht mehr miterleben durften. Das wäre bestimmt sehr lustig geworden und wäre sicherlich in aller Unerbittlichkeit quer durch alle Medienkanäle ausgetragen worden.
Guttenberg hätte es nie ausgehalten, mit einer Enthaltung im UN-Sicherheitsrat zur Libyen-Resolution vor seinen vielen amerikanischen Freunden auf die Knochen blamiert zu werden. Das wäre spannend geworden, zu wem in diesem Zwist Angela letztendlich gehalten hätte. Einer der beiden wäre auf alle Fälle politisch so beschädigt gewesen, dass er hätte zurücktreten müssen, schon aus reiner Selbsterhaltung. – Eigentlich schade, dass Guttenbergs Doktor-Schmu nicht ein paar Wochen später aufgedeckt worden ist. Vielleicht wäre uns so Westerwelles sonderlicher Populismus-Pazifismus erspart geblieben. – Im dekadenten Rom hat man nicht zufällig niemals Volkstribune für diplomatische Aufgaben eingesetzt. Agitatoren waren noch nie gute Moderatoren.